Die Faszination der Biologie
Die Faszination der BiologieDo, 26.04.2012- 05:20 — Eva Sinner
Eva-Kathrin Sinner, o.Prof. für Nanobiotechnologie an der Universität für Bodenkultur in Wien, im Gespräch mit dem ScienceBlog. Die renommierte Biowissenschafterin erzählt über ihren Werdegang und von Möglichkeiten, das allgemeine Interesse an Naturwissenschaften zu stimulieren.
SB: Biologie wird als Leitwissenschaft des ausgehenden 20. Jahrhunderts bezeichnet. Was bedeutet Biologie für Sie, Frau Professor Sinner?
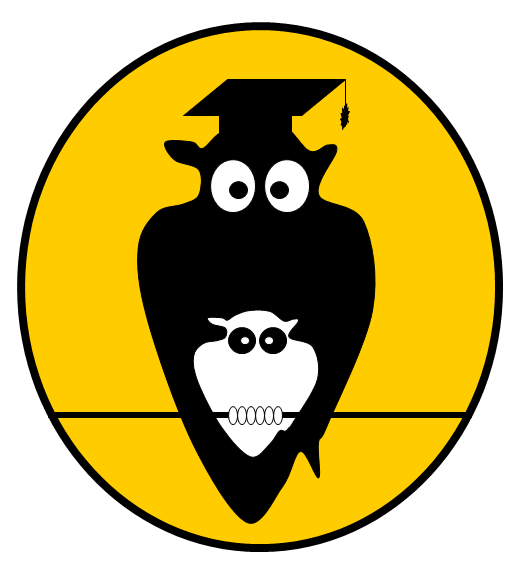 Logo v. Eva Sinner & ihrer Tochter (symbolisiert die Wissenschaftlerin mit ihrer Tochter)
Logo v. Eva Sinner & ihrer Tochter (symbolisiert die Wissenschaftlerin mit ihrer Tochter)
E-K S: Biologie ist die Lehre des Lebens. Es ist faszinierend, dass wir heute bereits in das „ganz Kleine“ schauen können: Die Bausteine des Lebens sind ja um Größenordnungen kleiner, als wir mit dem Auge erkennen können. Wir leben in einer Welt, in der wir üblicherweise Dimensionen von Millimetern bis zu Kilometern wahrnehmen. Darunter – d.h. für unsere Augen bereits unsichtbar - liegt aber die Welt der Bakterien und Mikroorganismen und noch weiter darunter befindet sich die Welt der „Nano (= Zwergen) Einheit“. Als Biologe arbeitet man mittlerweile eng mit anderen Naturwissenschaftlern und Medizinern zusammen.
Es ist faszinierend in der gemeinsamen Perspektive auf Mechanismen, Strukturen und möglichen (technischen) Anwendungen die Natur zu erforschen.
SB: Der Untersuchung von Strukturen und Mechanismen haftet häufig der Geruch einer Forschung im Elfenbeinturm an....
E-K S: Forschung ist kein abstrakter Begriff für mich und ich wünsche mir auch, daß die Gesellschaft dafür Interesse bekundet und daran teilhat.
Es gibt ja Fragestellungen, welche die Natur bereits in Perfektion gelöst hat - die Natur kann uns „vorsagen“, wie wir beispielsweise nachhaltig mit Energiefragen umgehen können; hier ist die Photosynthese ungeschlagen in ihrem Wirkungsgrad. Oder die medizinische Seite, wenn es etwa um die Diagnostik von Krebserkrankungen geht, auch hier gibt es Parameter, wie Markerproteine, die wir in einen neuen Kontext stellen können– nämlich in den einer Früherkennungsstrategie.
So sind es sicherlich Fragen aus dem „hier und jetzt“, die wir „in der Biologie“ untersuchen und das universitäre Umfeld erlaubt es, sowohl die Basis der Wissenschaft im Auge zu behalten, als auch die Sinnhaftigkeit und Relevanz für die Gesellschaft.
Ich freue mich, wenn Studenten der Biowissenschaften immer breitere Perspektiven haben, in denen ihr Wissenshorizont eine Rolle spielen kann - von einem Pflanzenforscher bis zu einem Firmengründer, von einem Bürgermeister bis hin zu einem Anarchisten.
SB: Kommen wir zu Ihrem eigenen Werdegang. Wenn Sie in Ihre Kindheit zurückschauen - wann haben Sie begonnen sich für Biologie zu interessieren und wie hat sich dies geäussert?
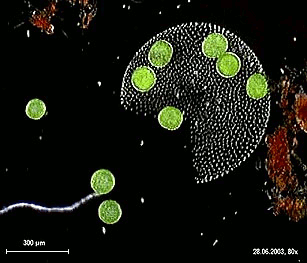 Volvox aureus (R.Wagner, Wikipedia)
Volvox aureus (R.Wagner, Wikipedia)
E-K S: Ich denke mal, ich war ‚ganz normal’ begeistert von allem, was lebte. Ich denke, es sind Orientierungen, die jedes Kind sucht, wenn die Welt der Erwachsenen zu kompliziert und zu fremd erscheint – dann gibt es den inneren Rückzug. Bei mir half ein Kindermikroskop, das mich den Gartenteich meiner Eltern hat tröpfchenweise „durchmikroskopieren“ lassen. Die Abbildung der kleinen Lebewesen in J.J. Grandville, “Volvox” aus dem Buch „Un Autre Monde“ – und ein Biologielehrer, der gleichzeitig Tierarzt war, taten ein Übriges.
SB: Wahrscheinlich teilen auch heute die meisten Kinder Ihr Interesse und Ihre Begeisterung am Lebendigen. Warum gehen diese Anlagen dann verloren? Kamen Ihnen persönlich jemals Zweifel auf, daß Biologie für Sie die richtige Wahl war?
E-K S: Mein Studium war nicht geradlinig. Nach einem nicht gerade grossartigen Abschluß eines humanistischen Gymnasiums, auf dem ich sicherlich aus Versehen gelandet war, hatte ich keine Ahnung von der Chemie. Eine durchgefallene Klausur in der Lebensmittelchemie der Universität Hannover bescherte mir ein Jahr Pause, da ich ohne diese Prüfung bestanden zu haben, nicht das nächste Praktikum machen durfte, welches für das Vordiplom Voraussetzung war. Für mich war damals genau die Frage erreicht, ob ich überhaupt in der Biologie „zuhause“ sein konnte.
Dann habe ich aber in Herrn Prof. Klaus Kloppstech aus der Botanik einen Lehrer gefunden, bei dem ich im Labor mitarbeiten durfte. In der Zwischenzeit inskribierte ich mich bei der Chemie und hatte dann zurück in der Biologie die nötigen Grundlagen um in einer exzellenten Naturstoffvorlesung von Herrn Prof. Habermehl die Anwendung meines neuerworbenen Wissens zu sehen.
Aus dieser Erfahrung kann ich nur raten: Die direkte Interaktion mit Universitäten und die Nutzung von Angeboten der direkten Besichtigung und Kontaktaufnahme – und das in jeder Lebensphase in dem einem „danach ist“ - nur so kann die Initialzündung erfolgen.
SB: Ihr Studium hatte also interdisziplinären Charakter - Biologie, Chemie, Naturstoffe – ebenso Ihr weiterer Werdegang in der biophysikalischen Forschung, in der Sie ja sehr schnell Karriere gemacht haben.
E-K S: Es sind immer Inspirationen, die zu den „roten Fäden“ führen in einem Lebenslauf. Ich erlaube mir, Herrn Prof. Helmut Ringsdorf sinngemäß zu zitieren „Wissenschaft passiert nie logisch, höchstens chronologisch“. Es ist weichenstellend für mich gewesen im Arbeitskreis von Herrn Prof. Knoll am Max Planck Institut für Polymerforschung in Mainz, Doktorarbeit machen zu können – als erste Biologin an einem Polymerforschungsinstitut. Mit 37 Jahren hatte ich meinen ersten Ruf an die Universität Regensburg, mit 39 die Berufung auf die Professur für Nanobiotechnologie hier an der Universität für Bodenkultur in Wien (und damit meinen ersten unbefristeten Arbeitsvertrag). Dazwischen lagen Japan und Singapur. Orte, an denen die Inhalte mich bewegten, dort lernen, bzw. forschen zu wollen. Die Max Planck Gesellschaft war lange Zeit meine wissenschaftliche Heimat gewesen und ich hatte das Glück bei Herrn Prof. Oesterhelt in Martinsried habilitieren zu können. Nach wie vor ist die Proteinbiochemie mein Hauptfach in Forschung und Lehre.
SB: Also ein äußerst erfolgreicher Werdegang.
E-K S: So würde ich meinen Werdegang nicht bezeichnen – mit dem „Elitemaßstab“ bin ich nie in Berührung gekommen, es war mehr das Glück und meine Offenheit, zu hören und irgendwann auch gehört zu werden. Diesbezüglich war beispielsweise die Einladung von Herrn Prof. Wegner an einer „exploratory round table conference“ der Max Planck Gesellschaft teilzuhaben, wo es um die Thematik „synthetische Biologie“ ging, ein Erfolgserlebnis, ebenso wie die Preisverleihung durch Frau Traudl Engelhorn-Vecciato für eine gute Idee in der Herstellung von „schwierigen“ Proteinen anlässlich der Winterschule von Herrn Prof. Manfred Eigen.
SB: Um den von Ihnen oben zitierten Satz „Wissenschaft passiert chronologisch“ Ihrer Biographie entsprechend zu ergänzen, muß man hinzufügen „und verbunden mit hoher Mobilität“.
E-K S: Mobilität ist Vorteil und Problem gleichzeitig. Es sind viele Faktoren und Orte an denen Forschung, Erfahrung und Lehre stattfinden. Die Wurzellosigkeit ist ein negativer Aspekt der Forschung und das Unverständnis der Umwelt für die Unvorhersehbarkeit von Forschungsergebnissen macht es nicht besser. Ich persönlich bin kein Weltenbummler, aber nolens volens ist es so geworden. Acht berufsbedingte Umzüge zähle ich in meinem Leben, keiner davon passierte „weil ich so gerne umziehe“.
SB: Wenn man Ihre Biographie betrachtet, so findet man kaum Anhaltspunkte dafür, daß Sie als Frau vor dem Problem gestanden wären die vielzitierte „gläserne Decke“ durchstoßen zu müssen.
E-K S: Zur Frage nach der „Geschlechterspezifität“ in meiner Wahrnehmung in Forschung und Lehre habe ich viele Erfahrungen gemacht, bzw. vieles berichtet bekommen. Ich wünschte, es wäre einfach kein Thema mehr, ob es sich um Männer oder Frauen handelt und habe mir vorgenommen, dass es mir schlicht egal ist. Mit meiner Ignoranz gegenüber den immer noch herrschenden Vorurteilen in jede Richtung bin ich gut gefahren, zumindest habe ich mich selten ärgern müssen.
Ich möchte dabei gleich vorwegnehmen, dass für mich sowohl weibliche, als auch männliche Studenten Menschen sind, die natürlicherweise als „Studenten“ beschrieben werden können. Meine Privatmeinung dazu stelle ich gerne zur Diskussion: ich halte die „–Innen“ Lösung für schlicht „sprachlich mühsam“ und möchte daher auf die besondere Verwendung einer weiblichen Wortform verzichten.
SB: Forschung und Lehre - Was versuchen Sie Ihren Studenten zu vermitteln?
E-K S: Es geht mir um die Weitergabe des Wissens ‚um das Leben’. Auch wenn durch die Breite der Fächer es nur Facetten sind, auf die sich ein Forscher beziehen kann – so entwickelt sie oder er eine Kompetenz, die es gilt, weiterzugeben. Dazu gehören Studenten, die sich nicht abschrecken lassen von „Elite“ oder „Studienzeitenlimitierung“, sondern die standhalten, wenn es um Inhalte geht, auch wenn sie zunächst fast lebensfeindlich klingen mögen, wie die „Nanotechnologie“. Mein Eingang in die Thematik ist dazu, dass ein Verständnis der Möglichkeiten, zum Beispiel der Möglichkeiten der Gentechnik, erst überhaupt eine Mitsprache und Mitgestaltung ermöglicht – glaubt denn wirklich jemand ernsthaft, dass die Beschäftigung mit einer Wissenschaft überflüssig ist, um sie kritisch beurteilen zu können? Wer weiss denn schon, was eigentlich ein „Gen“ ist?
Die sogenannte ‚Medienreligion’ ist nicht dienlich, wenn es um Vermittlung von Inhalten geht, die nicht auf der populistischen Skala ganz oben stehen – ich denke, die Grundlage für eine inhaltliche Diskussion schwieriger Themen, wie der Gentechnik, fehlt in der Gesellschaft.
SB: Damit sprechen Sie ein enorm wichtiges Problem an: unserer Gesellschaft fehlt die Grundlage für eine inhaltliche Diskussion schwieriger naturwissenschaftlicher Themen, wie sie jedoch immer dringlicher werden. Wie sollte man Ihrer Meinung nach vorgehen um generell das Interesse an Naturwissenschaften zu stimulieren? Um unseren Jungen naturwissenschaftliche Berufe erstrebenswert erscheinen zu lassen?
E-K S: Bei den Jungen gilt es die Scherben aufzukehren, welche die Schulzeit bei Vielen erzeugt hat. In erster Linie geht es darum bei weiblichen Studenten ein Selbstbewusstsein zu erzeugen, das schlicht fehlt - beginnend von der früh installierten Phobie vor Zahlen und analytischen Betrachtungsweisen, bis hin zu einer Bestärkung der Machbarkeit in der Vereinigung von Familie und Beruf. Auf der anderen Seite, sollten männliche Studenten bestärkt werden, ihre Väterrolle ebenfalls vereinbar mit einer beruflichen Perspektive in den Naturwissenschaften zu sehen: ein Studium ist zwar keine Berufsausbildung, aber steht dahinter ein Arbeitsmarkt, welcher langfristig vorausschaubar für Naturwissenschaftler Bedarf hat, dann ist das eine große Beruhigung. Wenn es auch ein internationaler Arbeitsmarkt sein kann, dann gibt es auch einen positiven Aspekt der oft zitierten Globalisierung, denn: die Welt ist gross!
Persönlich gesehen, finde ich es befremdlich, dass auch ‚Väterstudenten’ ziemlich „schräg“ beäugt werden und noch weniger in die heute vorgegebenen Strukturen zu passen scheinen, als es für die als normal betrachteten jungen Mütter der Fall ist. Das macht es nicht leicht, zu behaupten, dass Naturwissenschaften in jedem Fall zu einer optimalen Lebensplanung gehören. Ich bin jedoch ein Optimist und glaube an eine positive Entwicklung der Gesellschaft in Bezug ihrer Akzeptanz gegenüber „unkonventionellen“ Lebensmodellen und einem gelebten Respekt gegenüber einer geschlechtsneutralen Elternrolle. Ich habe ja selber versucht, Beruf und Familie zu verbinden und habe es nicht geschafft.
Auf die Gesellschaft übertragen meine ich, daß man durch das Aufzeigen realistischer Perspektiven die Begeisterung an den Naturwissenschaften wecken kann. „Lebenslängliches lernen“ ist für mich keine Worthülse.
Ich habe die Gelegenheit gehabt, durchaus gestandene Forscher im hohen Alter erleben zu dürfen und das enorme Potential der soliden Basis verknüpft mit der legendären Neugier, die Herr Albert Einstein so einprägsam als Kriterium eines ‚Forschercharakters’ formulierte, zu sehen.
Nur wer viel gesehen und verstanden hat, kann assoziieren und damit neue Strategien entwickeln - in meinen Augen eine wichtige Art des Forschens.
SB: Wir danken für das Gespräch!
Anmerkungen der Redaktion
Forschungsprojekt: Schnüffeln für die Wissenschaft (Video, 7'30)
